-
Notizen zur Ästhetik
Reflexion
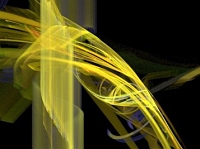
Ich stand vor der Situation, in der mein akademisches Leben gespalten war; ich konzentrierte mich auf die Suche nach den Antworten auf zwei Fragen, die in entgegengesetzte Richtungen zu führen schienen, nämlich: Was ist die Organisation des Lebendigen? Und: Was findet im Phänomen der Wahrnehmung statt?
Humberto MaturanaEs ist möglich, einem hungrigen Publikum ein menschliches Gehirn zu servieren, um an Hand physiologischer Merkmale komplexe Strukturen zu erörtern. Neben der geistigen Erregung dürfte sich ein weiteres Prinzip behaupten: sinnliche Erfahrung. Und sollte das Hirn noch frisch sein, so können wir es nicht nur sehen und fühlen, sondern auch riechen, schmecken, vielleicht auch hören. In der Summe ist das menschliche Gehirn Gegenstand intellektueller Spekulation und ästhetischer Genuss. Zwei sehr unterschiedliche Seiten manifestieren sich also in ein und demselben Objekt; es fällt jedoch schwer, sie miteinander zu verflechten
Descartes war sich seiner Sache sehr sicher. Mit Hilfe der Formel „cogito ergo sum“ (Ich
 denke, also bin ich) schien bloßes Sagen und Meinen überwunden. Erst dann, wenn nichts mehr in Zweifel gezogen werden kann, gelten Aussagen und Beschreibungen als wahr – nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Kunst. Die Wahrnehmung wird daher zum Gegenstand geistiger Betätigung. Und genau hier scheiden sich die Geister.
denke, also bin ich) schien bloßes Sagen und Meinen überwunden. Erst dann, wenn nichts mehr in Zweifel gezogen werden kann, gelten Aussagen und Beschreibungen als wahr – nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Kunst. Die Wahrnehmung wird daher zum Gegenstand geistiger Betätigung. Und genau hier scheiden sich die Geister.Für René Descartes gilt die absolute Trennung von Seele und Körper. Wie lässt sich dennoch eine Einheit realisieren? Anders gefragt: Wie gelingt es, Emotionen und Gedanken miteinander zu koppeln? Indem empfangende Reize registriert und zum Gehirn weiter geleitet werden. An einem Ort – Descartes erkennt ihn in der Epiphyse (besser bekannt als Zirbeldrüse) – findet die Interaktion statt. Wir haben ein Bild der äußeren Welt.
Die Neurowissenschaft hegt Zweifel; ein Interaktionsort, wie ihn Descartes postuliert, lässt sich nicht finden. In der Überwindung des cartesianischen Dualismus greifen die Physiologen zu anderen Mitteln, um den Vorgang der Reflexion zusätzlich ins rein subjektive zu verlegen. Der Gegenstand „Hirn“ wird also nicht nur als Objekt der Begierde begriffen, sondern ebenso als ein Aktionsmedium, das neue Eigenschaften der Natur hervor treibt. Das Hirn selbst ist ein eigener Kosmos. Wir zeichnen Bilder der inneren Welt. Im Raster dieser Ambivalenz liegt nunmehr der Schlüssel zur Begründung der Neuronalen Ästhetik.
Um zu verstehen, was das Schöne, Hässliche, Erhabene usw. ist, braucht man nur zu
 verstehen, wie das Hirn funktioniert. Nach Ernst Pöppel malt die Kunst die innere Grammatik des Hirns aus. Kunst greift demnach in die geöffnete Schatulle aller Hirnfunktionen und bedient sich deren Muster. Sie folgt dem geschlossenen Kreislauf der Natur. Von diesem Prinzip her ist das Ästhetische zu verstehen.
verstehen, wie das Hirn funktioniert. Nach Ernst Pöppel malt die Kunst die innere Grammatik des Hirns aus. Kunst greift demnach in die geöffnete Schatulle aller Hirnfunktionen und bedient sich deren Muster. Sie folgt dem geschlossenen Kreislauf der Natur. Von diesem Prinzip her ist das Ästhetische zu verstehen.Was bleibt dem Künstler? Er hat sich in das Hirn zu denken! Spielarten wie „künstlerische Freiheit“ und „autonomer Geist“ sind Gespinste eines Unverbesserlichen. Das Hirn sagt uns, was in der Kunst richtig und was falsch ist. Entweder kann das Hirn nur beiläufig lächeln, oder es dank mit fröhlichen Blitzen. Der „Einzige und sein Eigentum“ hat ausgedient. Er hat sich, konsequent zu Ende gedacht, an einem Universalhirn zu orientieren
Derartige Gedankenspiele sind nicht fremd. Auch bei Hegel blieb die Freiheit des Subjekts auf der Strecke. Nur das Große und Ganze zählte – die „Absolute Idee“, der „Weltgeist“. Aus ihm heraus flossen Hegels „Vorlesungen über die Ästhetik“, die, statt aufzubegehren, zur Abschreckung mahnten. Das Ästhetische schien bereit, sich abzuschminken.
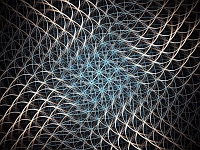 Humberto Maturana sichert im sozialen System „menschliche Gesellschaft“ dem „Einzigen“ Autonomie. Jedes geschlossenes Netzwerk (Hirn), das sich generiert, sich also „selbst macht“ (Autopoiese), erfreut sich gerade durch den hohen Grad seiner Autonomie einer unabhängige Existenz. Das soziale System ist wiederum angewiesen auf die Kreativität seiner Mitglieder, welche die Entwicklung von Kultur, Kunst und Bewusstsein garantieren.
Humberto Maturana sichert im sozialen System „menschliche Gesellschaft“ dem „Einzigen“ Autonomie. Jedes geschlossenes Netzwerk (Hirn), das sich generiert, sich also „selbst macht“ (Autopoiese), erfreut sich gerade durch den hohen Grad seiner Autonomie einer unabhängige Existenz. Das soziale System ist wiederum angewiesen auf die Kreativität seiner Mitglieder, welche die Entwicklung von Kultur, Kunst und Bewusstsein garantieren.Eine bedeutsame Aufgabe dieser Entwicklung übernimmt die Sprache in ihren mannigfaltigen Ausdrucksformen. Sprache ist dabei nicht die Übertragung von Informationen (Aufgabe der Kommunikation), sondern die Koordinierung des Verhaltens innerhalb von Bezugssystemen. Eine Familie ist zwar ein durch Blutsverwandtschaft gekennzeichnetes biologisches System, aber auch ein „begriffliches System“, das durch bestimmte Rollen und Beziehungen definiert wird. Hier ergeben sich Unterschiede zu anderen Bezugssystemen, die jeweils ihren „Dialekt“ reden. Eine Familie outet sich als „In-der-Sprache-sein“.
Schmerzlich musste Oedipus nach seiner Rückkehr in die Heimat erfahren, nicht mehr
 „In-der-Sprache“ des eigenen Stammes zu sein. In der Fremde hatte er eine andere Kultur genossen. Nunmehr war er gefangen in einem Netz von Mythos und Intrigen; es gab für ihn keinen anderen Ausweg, als sich das Augenlicht zu nehmen. Denn Oedipus stand erstarrten Strukturen gegenüber, die eine gemeinsame Sprache unmöglich machten.
„In-der-Sprache“ des eigenen Stammes zu sein. In der Fremde hatte er eine andere Kultur genossen. Nunmehr war er gefangen in einem Netz von Mythos und Intrigen; es gab für ihn keinen anderen Ausweg, als sich das Augenlicht zu nehmen. Denn Oedipus stand erstarrten Strukturen gegenüber, die eine gemeinsame Sprache unmöglich machten.
metamediale spiele
- Stoff und Form
- Inszenierung
Stoff und Form
 Eine schwingende Saite hat eine
Eine schwingende Saite hat eine
unbegrenzte Zahl von Freiheitsgraden,
so dass sie eine unendliche Anzahl
von Tönen von sich geben kann.
Deren Schwingungszahlen
sind das Vielfache
der Grundschwingungszahl.
Henri Pointcaré
Etwas anders als Pointcaré, der den Raum als schlaffe Form charakterisiert, die sich an allem anschmiegen kann, stellt Aristoteles in seiner Metaphysik fest, dass der Stoff (Raum) nur der Möglichkeit nach existiert, da er noch keine Form besitzt. Der Stoff ist ein Noch-Nicht-Seiendes, die Quelle der Unvollkommenheit, das Leidende schlechthin. Erst die Form gibt dem Stoff seine Erfüllung. Sie ist die bewegende Ursache. Die Form schafft den Übergang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit.
In der Kunst votiert der Stoff (das Thema oder Motiv) für seine  Entfaltung in ein Werk. Nur leidet nicht der Stoff, denn er gibt ja die Richtung vor, sondern der Produktionsprozess durchlebt dauernde Zerrissenheit. Das Thema kann sich also genüsslich zurücklehnen und auf seine Erfüllung warten. Der oder die Macher eines Kunstwerks sind in die aktive Rolle gezwungen.
Entfaltung in ein Werk. Nur leidet nicht der Stoff, denn er gibt ja die Richtung vor, sondern der Produktionsprozess durchlebt dauernde Zerrissenheit. Das Thema kann sich also genüsslich zurücklehnen und auf seine Erfüllung warten. Der oder die Macher eines Kunstwerks sind in die aktive Rolle gezwungen.
Der umgekehrte Weg, ein passives Aussitzen, führt zu Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Seine Figuren ergötzen sich schwätzend im Nicht Tun und überantworten sich ihrem vermeintlichen Heilsbringer Godot. In ihrer Rigorosität sind sie gelaunt, im Möglichen zu verweilen, ohne Wirklichkeit anzunehmen. Diesem Faulheitsprinzip konnte Lucian in seinem Dialog: „Der Parasit, oder Beweis, dass Schmarotzen eine Kunst sei“ Bedeutendes abgewinnen; denn ebenso wie all die anderen Künste hat auch die Parasitik einen Zweck. Zu dieser tüchtigen Wissenschaft gehört nämlich die konsequente Unterscheidung von nützlichen und unbrauchbaren Tischherren. (Dieses in die Neuzeit gerettete lächerliche Schönheitsprinzip können wir getrost ausblenden.)
Um uns ein Bild vom Gegenstand (Stoff) zu machen, den wir für die  Kunstproduktion nutzen wollen, muss er in seiner Komplexität begriffen werden. Er ist weder schlaffe Form noch ein Nicht-Seiendes. Er hat wie das Hirn eine eigene Geschichte. Wir schaffen ein Abbild, indem wir seiner Komplexität den Spiegel vorhalten. Dies hat Auswirkung auf die nichtlineare Erzählstruktur des Werkes, das wir zu bilden beabsichtigen.
Kunstproduktion nutzen wollen, muss er in seiner Komplexität begriffen werden. Er ist weder schlaffe Form noch ein Nicht-Seiendes. Er hat wie das Hirn eine eigene Geschichte. Wir schaffen ein Abbild, indem wir seiner Komplexität den Spiegel vorhalten. Dies hat Auswirkung auf die nichtlineare Erzählstruktur des Werkes, das wir zu bilden beabsichtigen.
Inszenierung
Der Raum, den wir betreten, hat seine eigene Poesie. Er ist zunächst Voraussetzung für eine Produktion. Arbeiten wir an ihm vorbei, hat das Stück (die Aufführung) verloren. Wir sind angehalten, seine Geheimnisse und Signaturen zu lesen. Wir müssen ihn „atmen“. Stoff und Form, besser: Raum und Drama, bedingen einander. Sie führen einen offenen Dialog, so dass ein gegenseitiges „Anschmiegen“ möglich wird. Hierbei entsteht ein erstes Muster, das für die Inszenierung von Bedeutung ist; denn aus diesem ersten Gefüge heraus lassen sich die metamedialen spiele ableiten. Analog zu Aristoteles, der die Metaphysik als die erste Philosophie, als eine Lehre von den ersten Prinzipien und den letzten Ursachen alles Seienden begreift, beschreiben wir mit metamediale spiele die Ausgangssituation. Sie selbst ist schon Inszenierung.
Wie eine Aufführung funktioniert, hängt vom Einsatz der Mittel  ab (Licht, Ton, Video etc.). Im Raum positioniert, nehmen sie zueinander Beziehungen auf und erzeugen somit eigene Muster (Autopoiese). Obwohl miteinander verschränkt, bewahrt jedes Mittel Autonomie. Es ist nicht an lineare Prozesse gebunden, sondern folgt eigenen Befindlichkeiten, wodurch andere, neue Muster entstehen. Das Stück inszeniert sich selbst.
ab (Licht, Ton, Video etc.). Im Raum positioniert, nehmen sie zueinander Beziehungen auf und erzeugen somit eigene Muster (Autopoiese). Obwohl miteinander verschränkt, bewahrt jedes Mittel Autonomie. Es ist nicht an lineare Prozesse gebunden, sondern folgt eigenen Befindlichkeiten, wodurch andere, neue Muster entstehen. Das Stück inszeniert sich selbst.
Das Thema, das wir behandeln, liegt entweder als Text, kompositorischer Fetzen oder als Filmsequenz vor – ein Torso, das von den einzelnen Mitgliedern der Produktion frei übersetzt werden kann. So treffen verschiedene Interpretationsweisen aufeinander, die ihren Ausdruck im Tanz, Schauspiel, Film, Malerei etc. finden. Ein erstes Aufeinandertreffen klingt scheinbar nach Kakophonie; wir erleben jedoch, dass sich während des Zusammenspiels der Beteiligten Empfindungsnetzwerke „spinnen“. Diese halten das Spiel zusammen. Sie sind keine festen, statischen Strukturen, sondern offene Systeme, die wiederum Improvisationsflächen kreieren. Das Stück zeigt sich als ein lebendiger, pulsierender Organismus.
Regie, in traditioneller Lesart fraglich, versteht sich als Koordinierung der Empfindungsnetzwerke. Der Koordinator arbeitet mit selbstständig agierenden Subjekten. Sie wissen, was sie tun. Seine Aufgabe beschränkt sich auf den Aufbau dynamischer Systeme. Er sorgt zugleich dafür, dass vereinbarte Prioritäten erhalten bleiben. Immerhin soll eine Geschichte erzählt werden. Entsprechend dieser Richtlinien formuliert sich der dramaturgische Leitfaden.
Jede Produktion besitzt ihre eigene Identität. Sie spricht ihren „Dialekt“, der in Bildern und Metaphern aufscheint. Ändern sich jedoch die Ausgangswerte, so ändert sich auch das Beziehungsgefüge. Es entstehen neue Muster. In diesem Kontext erschließen sich die variablen Begriffe Schön, Hässlich, Erhaben usw. Sie sind Reflexionen auf sich selbst und bedeuten: „In-der-Sprache-sein“
via regia
oder Die Lust zu Handeln
VERSUCH EINER POETIK
Vortrag anlässlich des internationalen Kolloquiums:
“Grenzüberschreitungen und Europäische Visionen”
Potsdam, 30. September 2006
Wir sind uns unbekannt
wir Erkennenden
wir selbst uns selbst:
das hat seinen guten Grund.
Wir haben nie nach uns gesucht.
Friedrich Nietzsche
Zur Genealogie der Moral
Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge im März 1957 waren die Weichen für die Europäische Wirtschaftsunion gestellt. Heute, fünfzig Jahre später, scheint das Werk vollendet. Der gesamte Kontinent hat sich – bis auf Ausnahmen – zu einem ökonomischen Ganzen vereint. Doch bei dessen Betrachtung fällt die Bilanz nicht positiv aus. Hatte Europa im Zuge seines Werdens häufig mit Grenzräumen und Grenzsituationen zu tun, die dennoch Möglichkeiten offen ließen, alle Richtungen und Wege zu beschreiten, so zeigt sich heute das ganze System als ein Rückfall in die Barbarei. Anstatt die emotionalen und intellektuellen Potentiale zu bündeln, keimten erneut die alten Tugenden individueller und nationaler Egoismen auf. Die Mentalität des Kleinkrämers hat also überdauert. Um dennoch den Schein des Gemeinsamen zu wahren, wurde der EURO als einheitliches Zahlungsmittel eingeführt. Und damit beginnt das eigentliche Problem; denn das einzelne Subjekt ist gänzlich im EURO aufgegangen, es ist unter dem allgemeinen Prinzip EURO subsumiert. Alle Lebensbereiche, alle Lebensqualitäten sind also in Geld gegossen – und der Preis ist nicht verhandelbar. Das moderne Europa wandelt somit auf mittelalterlichen Spuren – denn auch dort galt das Prinzip des Allgemeinen. Nur lagen damals die Seiten des Bewusstseins unter dem Schleier von Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn. Die christliche Mystik koordinierte auch alle Denkformen – bis hin zur Philosophie. Die Philosophie verstand sich selbst als Hure der Theologie. Einzig was zählte, war die Intellektuelle Liebe zu Gott.
nicht anders in der Kunst. Auch sie bemüht sich heute um das Totschweigen von Subjektivität. Die moderne Kunst aalt sich in einer Themenverknappung, die in der ewigen Wiederkehr des Gleichen ruht. Die Stilrichtung heißt: main stream – die billigere Art von Naturalismus. Und dieser beschreibt sich als Postmoderne oder als Post-Post-Moderne, ausgestattet mit einem schizoiden Haschen nach Pikantem und Paradoxem. Dabei steht die moderne Kunst auf sehr dürren, zittrigen Beinen – stets in der Angst, vom Mammon erschlagen zu werden. Diese Absurdität künstlerischen Seins findet den Höhepunkt in der Verwendung von Sprache. Den Sprachschatz auf ein Minimum reduziert, kümmert sie sich eher um die Diktatur sinnloser Schreibregeln als um Kreativität. Sprache heute ist der zusammen geschobene Denkkehricht. Hatte Aristoteles den Menschen seiner Zeit noch als politisches Tier gezeichnet, so dürfte heute der Gebrauch Darwin’scher Definition glücklicher sein: Der Mensch gehört zur Spezies der Schmalnasenaffen. Wie also fällt die Bilanz des modernen Europa aus? Im Sinne von Erich Maria Remarque:
“Im Westen nichts Neues”. (!)
die Frage lautet nun: Wie kommt man aus diesem selbst verschuldeten Dilemma wieder heraus? Welche Inhalte sind zu beachten, die ein Leben in der Moderne erträglich machen?
Eine erste mögliche Antwort liefert uns die Epoche der Renaissance; denn hier wird erstmals wieder das Subjekt ins Zentrum der Intentionen gestellt. So, wie sich einst der Grieche mit seinem Selbstbewusstsein über die Barbaren erhob, ebenso erhebt sich zuerst in Italien das freie Subjekt mit voller Macht über alle Umklammerungen. Es erkennt sich als Gestalter der Welt. Die weitaus größere Leistung der Renaissance ist jedoch, dass sie den vollen Gehalt des Menschen zutage fördert – in der Begründung des Humanismus. Weit über den heutigen Dilettantismus hinausgehend, war der florentinische Kaufmann sowohl Staatsmann als auch Gelehrter, der die beiden alten Sprachen Griechisch und Latein beherrschte. Der Humanist war also stets zur größten Vielseitigkeit aufgefordert. Die objektive Kenntnis der antiken und der mittelalterlichen Geschichte waren für ihn keinesfalls Selbstzweck, sondern sein Wissen hatte in erster Linie der täglichen Anwendung auf das wirkliche Leben zu dienen. Die zweite mögliche Antwort liefert uns demnach das Modell der Vielseitigkeit. Wenn Leon Battista Alberti in seinem Traktat de pictura (Über die Malkunst) von 1438 die Frage nach dem idealen Maler stellt, dann stellvertretend für alle Künste: Als ein idealer Maler galt, wer sowohl die Züge eines beschlagenen, innovativen Ingenieurs aufzuweisen hatte und wer in allen Künsten und vor allem aber in Literatur und Kritik bewandert war. Schlicht: Er musste Humanist sein. Zu diesem neuen Dasein wollte Alberti den Künstler verhelfen, durch Bildung und Erziehung, durch die Formung des Geistes.
was bedeutet das für die Moderne? Einfach: Sie ist angehalten, nach allen Seiten hin Ausschau zu halten und die unterschiedlichsten Ebenen geistiger Betätigung miteinander in Beziehung zu setzen. Und dabei geht es nicht um das Setzen von Prioritäten. Wissenschaft ist ebenso wie Kunst oder Wirtschaft jeweils nur eine Form menschlichen Tuns. Auch Geld spielt dabei nur eine Rolle – und nicht die Rolle. Diese unterschiedlichen Ebenen sind also miteinander zu Verweben, so dass in deren Zusammenspiel Muster entstehen. Es ist, wie wenn man in einem Kuppelsaal von verschiedenen Standpunkten aus Töne singt. Diese Laute sammeln sich genau in einem einzigen Punkt, im Zenit, und werden wie durch Geisterhand mit volle Wucht nach unten geführt. Das entstandene Muster ist ein Grundton oder der Superton – wie ihn die Chaostheorie beschreibt -, ohne dass dabei einzelne Stimmen verschmiert werden. Wir müssen also nicht nach einer einzigen, nach der einzig wahren Weltformel suchen – wie es gegenwärtig die Stringtheorie tut. Entscheidend sind immer die Muster.
aus dieser Perspektive sei nunmehr ein etwas anderer Blick auf die Moderne erlaubt. Und aus dem Blickwinkel der Kunst erscheint Europa plötzlich als Experimentierfeld. Dabei gilt es zunächst nur einen Ausschnitt zu betrachten. Das besondere Interesse gilt dabei dem Thema: EU-Osterweiterung. Denn die in die Europäische Union integrierten Länder wie Litauen, Estland und Lettland bilden heute einen fast vergessenen Lebensraum, den es zu ergründen lohnt. Der Reiz besteht auch darin, da das Baltikum ursprünglich mit dem westlichen Europas verbunden war. Denn zwischen den alten Hansekontoren Brügge (Belgien) und Novgorod (Russland) erstreckte sich eine seit Jahrhunderten für den Austausch von Waren und Informationen genutzte Wegstrecke. Diese via regia verband also Orte und Städte miteinander, um an idealen Schnittpunkten Handel im weiteren Sinne zu treiben. Handeln im Sinne von künstlerischer Tätigkeit bedeutet konkret, an diesen historisch entstandenen Fixpunkten Ausstellungen mit Künstlern aus diesen Osteuropäischen Ländern zu organisieren, mit dem Ziel, verlorene Informationen wieder in den europäischen Gesamtkontext zu stellen. Dabei geht es nicht um ein bloßes Zur-Schau-Stellen von Exponaten, sondern um den Diskurs. Über das Mittel der Kunst soll hierbei die Diskussion um das europäische Gewissen (Trennung der Staatengemeinschaft) angeregt werden. Und es geht um die Wiederherstellung des kollektiven Wissens in Form einer neuen Formulierung europäischer Geschichte.
auch hier, bei diesen Zusammenkünften, soll das Modell Muster greifen – eben im Zusammenspiel aller Genre. Der Aktionsradius umschließt die Künste: Malerei, Bildhauerei, Architektur, Landschaftsgestaltung, Literatur, Film, Theater, Musik und Tanz. So werden zum Beispiel die Inhalte und die Farben der ausgestellten Bilder von der Musik oder vom Tanz “aufgenommen”, um sie an die Literatur oder den Film “weiterzugeben”. Durch Improvisation der einzelnen Mitglieder wird ständig ein Muster, ein offenes, ein Gesamtkunstwerk geschaffen. Und alles ist in Entstehung und Entwicklung begriffen. Jede durchlaufende Station ist ein neuer kommunikativer Anfang. Der Dialog ist gesetzt. Er behandelt zugleich das Wertverständnis von Tradition und Moderne und damit Die Genesis der Europäischen Union.
vielleicht bedarf es für dieses Verständnis eines längeren Atems. Die Zeit sei gegeben. Denn die Eule der Minerva beginnt erst in der Dämmerung ihren Flug.